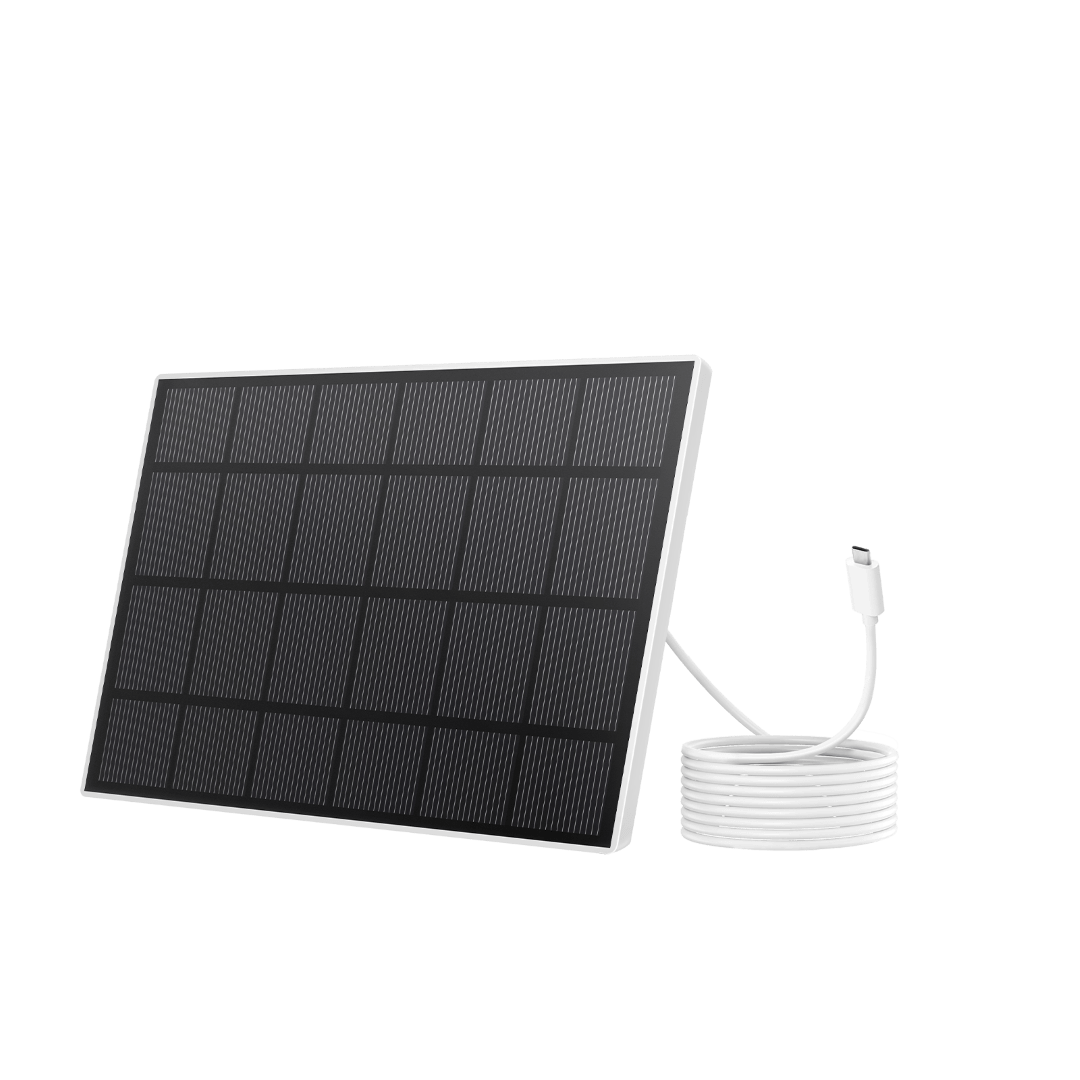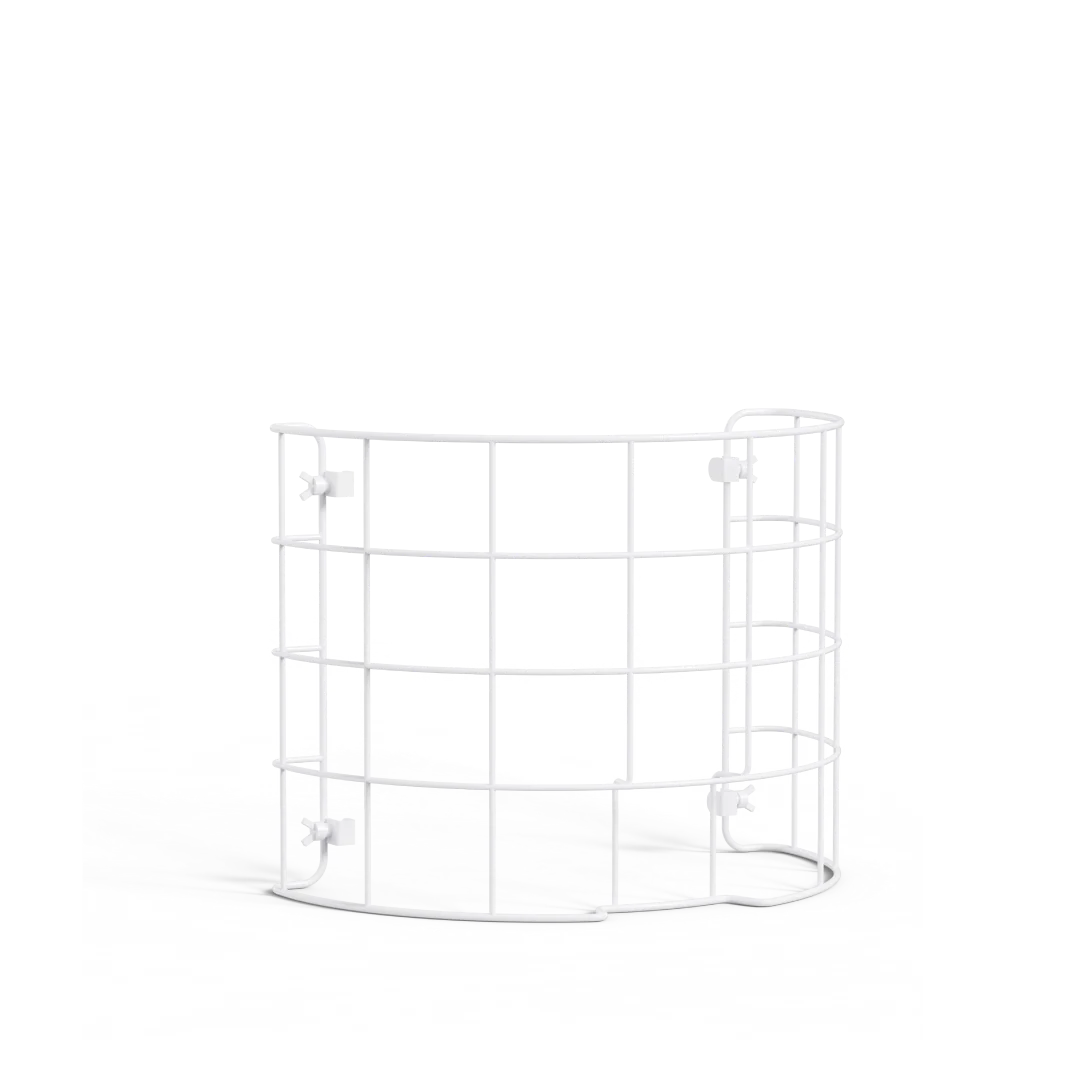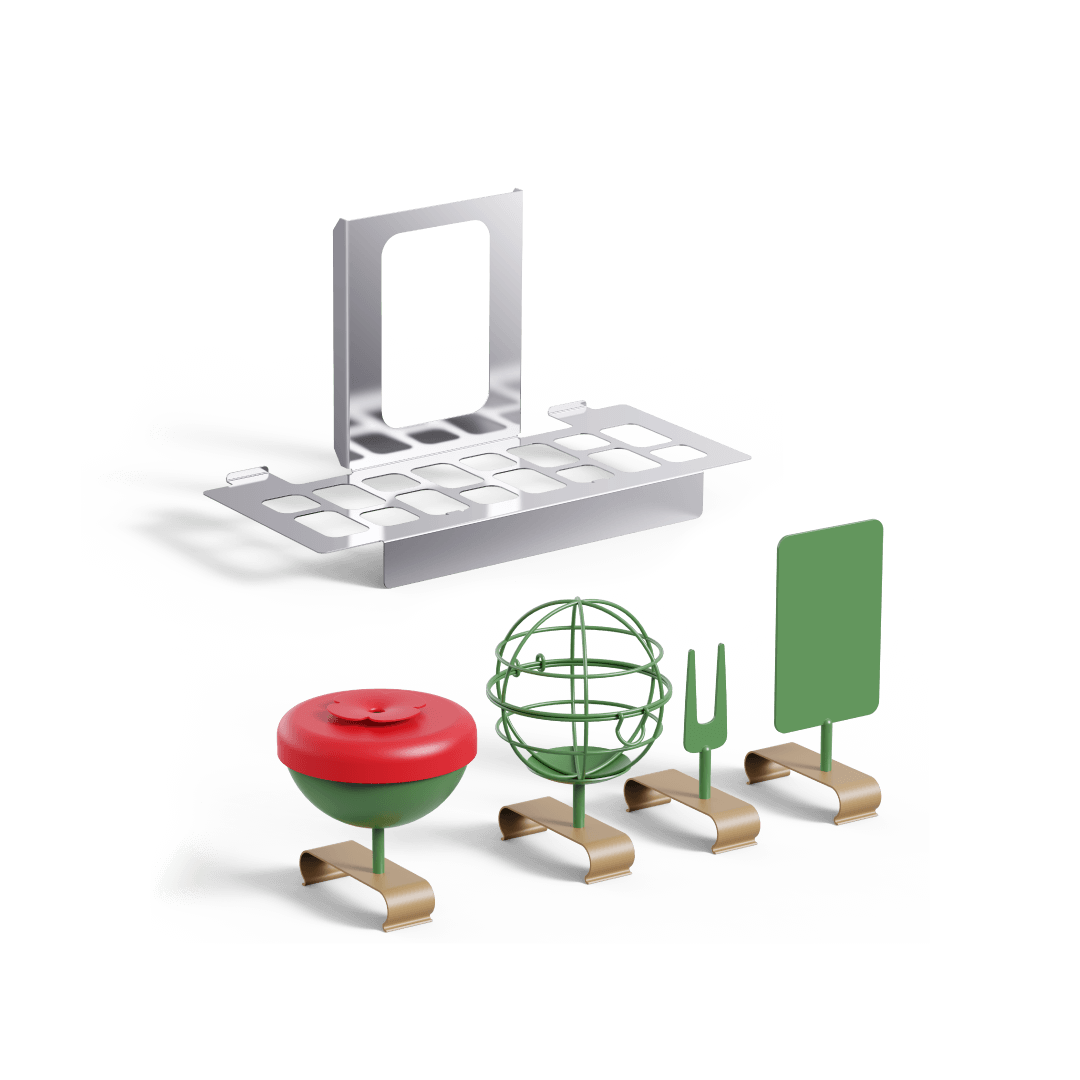Der Blaukehlchen: Ein Überblick mit wissenschaftlichen Daten und Studien
von/ durch Birdfy Team
auf Feb 10, 2025
Um das Leben des Blaukehlchens und seine Bedeutung im Kontext des Lebensraumschutzes besser zu verstehen, folgen hier einige spezifische experimentelle Daten und wissenschaftliche Studien.
1. Zugverhalten und Lebensraumwahl
Eine 2015 durchgeführte Studie der BirdLife International über das Zugverhalten des Blaukehlchens ergab, dass das Blaukehlchen eine feste Zugroute beibehält, die es aus den Brutgebieten in Nordeuropa und Russland in den Nahen Osten und den Mittelmeerraum führt. Durch die Verfolgung eines mit GPS-Gerät ausgestatteten Blaukehlchens namens "RZ76" fanden Forscher heraus, dass das Tier 2015 aus Schweden nach Spanien zog und dabei rund 3.000 Kilometer zurücklegte. Diese Studie liefert wertvolle Daten zum Zugverhalten und zur Lebensraumwahl des Blaukehlchens und beleuchtet auch die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf Zugrouten von Vögeln.

2. Fortpflanzungsverhalten und Brutdauer
Laut einer Untersuchung des Deutschen Vogelwarte-Instituts aus dem Jahr 2018 erstreckt sich die Brutzeit des Blaukehlchens von Mitte April bis Juni. Die Weibchen legen im Durchschnitt 4 bis 6 Eier, und die Inkubationszeit beträgt in der Regel 14 bis 16 Tage. Die Studie stellte zudem fest, dass Blaukehlchen in Gebieten mit höherer Lebensraumqualität eine höhere Brut-erfolgsrate aufweisen, wobei die Überlebensrate der Jungvögel bei etwa 75 % liegt. In natürlichen Schutzgebieten in Deutschland beispielsweise lag die Brut-erfolgsrate des Blaukehlchens etwa 30 % höher als in landwirtschaftlich genutzten Flächen.

3. Erfolge im Lebensraumschutz und -wiederherstellung
Im Jahr 2019 führte die Deutsche Naturschutzbehörde (Bundesamt für Naturschutz) mehrere Projekte zur Lebensraumwiederherstellung des Blaukehlchens durch. In einer vergleichenden Analyse der Jahre 2010 bis 2019 bezüglich der Blaukehlchenpopulation in verschiedenen Feuchtgebieten Deutschlands stellte man fest:
- In Gebieten ohne Lebensraummaßnahmen nahm die Blaukehlchenpopulation um etwa 20 % ab.
- In Gebieten, in denen Feuchtgebietsrestaurierungen und Lebensraumschutz durchgeführt wurden, blieb die Blaukehlchenpopulation stabil, mit teils sogar wachsender Zahl. Zum Beispiel wuchs die Blaukehlchenpopulation im Unteres Odertal Nationalpark in Brandenburg von 2010 bis 2019 um etwa 15 %, nachdem dort ein Lebensraumwiederherstellungsprogramm implementiert wurde.
4. Zusammenhang zwischen Nahrungsangebot und Brut Erfolg
Das Nahrungsangebot hat einen erheblichen Einfluss auf den Bruterfolg des Blaukehlchens. Eine Studie des Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) aus Großbritannien zeigte, dass Blaukehlchen während der Brutzeit hauptsächlich fliegende Insekten und andere wirbellose Tiere fressen, was für die Bereitstellung von Proteinen für die Aufzucht der Jungen von entscheidender Bedeutung ist. In Gebieten mit reichhaltigem Nahrungsangebot, wie Feuchtgebieten, ist die Überlebensrate der Jungvögel höher. In diesen Gebieten nehmen Blaukehlchen mehr Nahrung auf, was zu einer schnelleren Entwicklung und einer besseren Gesundheit der Jungvögel führt.

5. Genetische Forschung und Populationsgesundheit
Im Jahr 2017 führte das Niederländische Institut für Vogelbeobachtungen (Royal Netherlands Institute for Bird Research) eine genetische Studie zum Blaukehlchen durch. Die Untersuchung zeigte, dass die Gesundheit der Blaukehlchenpopulation eng mit der genetischen Vielfalt der Art verknüpft ist. Die Forschung ergab, dass der Verlust von Lebensräumen nicht nur die Fläche des Lebensraums verringert, sondern auch die genetische Vielfalt in den Populationen der Blaukehlchen reduziert, was sich negativ auf die Fortpflanzungsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit der Vögel auswirken kann. Durch die Analyse von Blaukehlchen in verschiedenen Gebieten stellte die Studie fest, dass in Regionen mit stark fragmentierten Lebensräumen die genetische Vielfalt der Vögel deutlich geringer ist, was langfristig das Überleben der Art gefährden könnte.

6. Globale Schutzmaßnahmen
Das Blaukehlchen ist laut der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) als „Least Concern“ (Geringe Sorge) eingestuft. Dennoch sind seine Lebensräume durch den Verlust von Feuchtgebieten und die Ausbreitung der Landwirtschaft gefährdet. Eine weltweite Vogelzählung, die von Global Bird Monitoring durchgeführt wurde, zeigte zwischen 2009 und 2019 einen leichten Rückgang der Blaukehlchenpopulation. Besonders betroffen sind Gebiete, in denen der Lebensraum zerstört oder fragmentiert wurde. Diese Studie ergab, dass die Fläche der Lebensräume des Blaukehlchens um etwa 15 % schrumpfte, was zu einem Rückgang der Population in einigen Regionen um etwa 10 % führte.

Schlussfolgerung
Die oben genannten Daten und Studien bieten uns ein tieferes Verständnis für die Lebensgewohnheiten des Blaukehlchens und seine Bedeutung im Lebensraummanagement. Die Forschung belegt, dass die Qualität der Lebensräume, das Nahrungsangebot, die Brutgewohnheiten sowie das Zugverhalten des Blaukehlchens entscheidend für sein Überleben sind. Die wissenschaftlichen Studien liefern solide Beweise dafür, dass Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Feuchtgebiete sowie die Erhaltung von ungestörten Lebensräumen notwendig sind, um diese Art auch in Zukunft zu erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass durch fortgesetzte Schutzbemühungen die Blaukehlchenpopulation in Europa und Asien weiterhin gedeihen kann.
Teilen